Konfessionelle Einrichtungen zum Umgang mit assistiertem Suizid
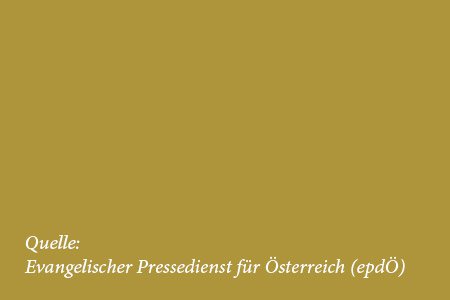
Diakonie-Direktorin Moser im Interview mit der FURCHE
Wien (epdÖ) – Aus Anlass des assistierten Suizids des unheilbar kranken Journalisten, Autors und Lehrers Niki Glattauer am 4. September hat die Wochenzeitung „DIE FURCHE“ mit zwei Verantwortungsträgern konfessioneller Einrichtungen gesprochen: Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und Christian Lagger, Geschäftsführer der Elisabethinen und Vorstandsmitglied in der ARGE der 23 österreichischen Ordensspitäler. Besondere Brisanz erhielt der begleitete Tod Glattauers durch ein vorab veröffentlichtes Interview in der Zeitung „DER FALTER“. Dieses Vorgehen sorgte für großes Aufsehen, erntete gleichermaßen Zustimmung wie Ablehnung.
Wie gehen Spitäler und Pflegeheime in kirchlicher Trägerschaft mit konkreten Sterbewünschen um? Und wie ermöglichen sie ein Lebensende in Würde? Für die aktuelle Ausgabe der FURCHE standen Moser und Lagger zu diesem Thema Rede und Antwort.
„Existenzielle Erfahrungen stehen immer für sich, und Erfahrungen am Lebensende sind immer existenzielle Krisen mit Widersprüchen“, antwortete Moser auf die Frage nach ihrer persönlichen Reaktion auf das Interview mit Niki Glattauer. Sie finde es sehr schwierig, Einzelfälle zu diskutieren. „Kommentiert man sie, dann wird das schnell als Bewertung interpretiert.“ Ihr habe das Interview „wieder einmal die Polarität verdeutlicht, die für die öffentliche Auseinandersetzung mit dem assistierten Suizid problematisch ist: Idealisierung oder Verdammung, Normalfall oder Verbot, Selbstbestimmung oder Lebensschutz.“ Die Frage sei, „wie wir darüber reden können, ohne in Extreme zu fallen“.
Laut FURCHE stehe der Vorwurf im Raum, dass der assistierte Suizid gerade in konfessionellen Häusern, besonders in katholischen, gleichsam „unter der Decke“ gehalten werde – auch was Beratung und Information betrifft. Darauf angesprochen unterstrich Lagger, dass man als Ordensspitäler alles tue, um Menschen zu begleiten, Schmerz zu lindern, palliativ-medizinisch, psychologisch und seelsorgerisch zu begleiten. „Das ist unser Angebot am Ende des Lebens. Wir bitten zu respektieren, dass der assistierte Suizid bei uns nicht möglich ist“, stellte Lagger klar.
Die Sterbewünsche von Menschen ernst nehmen
Auf die Frage, wie der assistierte Suizid in Einrichtungen der Diakonie gehandhabt werde, verwies Moser auf „unseren hospizlichen und palliativen Weg“. Der assistierte Suizid sei kein zusätzliches Angebot. „Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Sterbewünsche von Menschen ernst zu nehmen“, ergänzte die Diakonie-Direktorin. „Die existenziellen Nöte der Menschen sind uns wichtiger als die moralische oder ethische Beurteilung des assistierten Suizids.“ Man müsse über den individuellen Fall sprechen, statt kategorische Urteile zu fällen.
Auf die Nachfrage der FURCHE, ob für sie ein Fall vorstellbar wäre, in dem der assistierte Suizid die beste Lösung sei, antwortete Moser: „Wenn Sie so gespitzt fragen: Ein assistierter Suizid kann nie die beste Lösung sein. Aber er kann im Einzelfall die einzig mögliche sein.“
Als Fazit des durch das Vorab-Interview öffentlich gemachten assistierten Suizids von Niki Glattauer meinte Lagger, der Tod gehöre enttabuisiert. „Wenn der Beitrag eine breite Diskussion über das Sterben erreicht hat, dann ist das gut. Aber medienethisch erwarte ich mir eine vertiefte Diskussion: Hier dürfen wir als Gesellschaft nicht wegschauen“, so der Geschäftsführer der Elisabethinen. Und Diakonie-Direktorin Moser stellte die Frage in den Raum, wo und in welchen Settings über den Tod gesprochen werde. „Neben medialer Berichterstattung und politischen Debatten braucht es Räume, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, zum Beispiel Diskussionen in Pfarrgemeinden“, setzte sich auch Moser dafür ein, das Thema Tod nicht zu tabuisieren.
